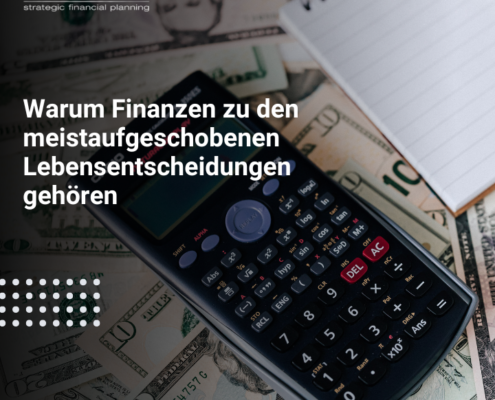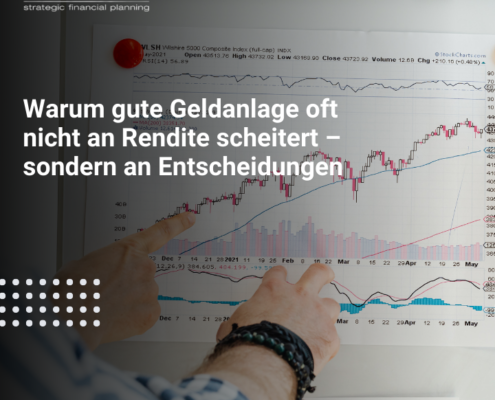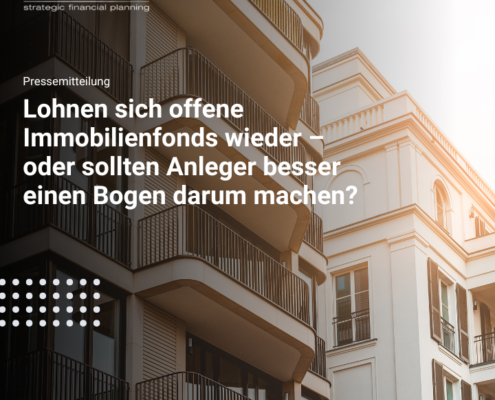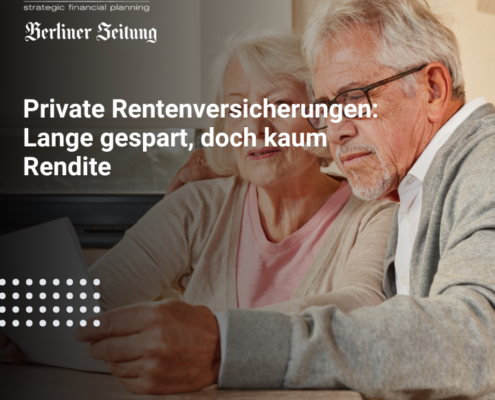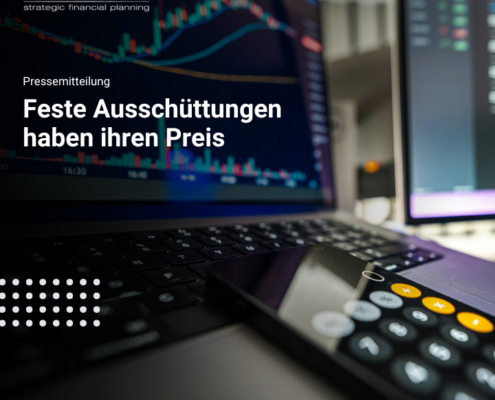Nachhaltigkeit bei ETFs: So erleichtert die EU jetzt die Orientierung am Aktienmarkt. Unser Interview mit der Berliner Zeitung
Nachhaltige Geldanlagen sind gefragt, denn die Anleger wollen guten Gewissens Rendite machen. Experten erklären, was sich am Markt ändert.
Aktiv gemanagte Fonds oder Indexfonds (ETFs), die auf die Werte Ökologie, Nachhaltigkeit oder soziale Unternehmensführung achten, sind beliebt. Einer aktuellen Untersuchung der Fondsgesellschaft Union Investment unter Großanlegern zufolge berücksichtigen 89 Prozent von ihnen Nachhaltigkeitskriterien bei Anlageentscheidungen. Gleichzeitig berichten die Analysten von Gegenwind, der diesen Geldanlagen entgegenbläst. Schuld sind gesetzliche Änderungen der EU im Bereich dieser Anlagen. Es herrscht Verunsicherung am Markt. Was neu ist und was das für Anleger bedeutet, erklären Experten.
ESG-Standards: Seit der Verabschiedung des EU Green Deals 2019 verfolgt die Europäische Union offiziell das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die politischen Maßnahmen der EU berücksichtigen dies auch in der Finanzpolitik. Eine Orientierung gibt der international anerkannte Standard ESG. Die Abkürzung steht für Environmental, Social und Governance, deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, und wird beim Verkauf von Finanzprodukten wie Fonds oder ETFs verwendet.
Um einem Missbrauch der Begriffe entgegenzuwirken, müssen seit Ende Mai alle Fonds, die Begriffe wie „ESG“, aber auch „nachhaltig“, „Klima“ oder „sozial“ im Namen tragen, nachweisen, dass mindestens 80 Prozent ihrer Investitionen tatsächlich den angegebenen Nachhaltigkeitszielen entsprechen. Investitionen in fossile Energien, Waffenhersteller, Tabakunternehmen und Unternehmen mit Menschenrechtsverstößen sind ausgeschlossen.
Hinter der Neuregelung steckt die ESMA, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde in Paris. Die unabhängige Behörde der Europäischen Union koordiniert die Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten, etwa die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um eine einheitliche Finanzaufsicht im europäischen Binnenmarkt zu gewährleisten.
Missbrauch des ESG-Labels: Dass dieser Schritt notwendig war, hat eine gemeinsame Recherche des Geldratgebers finanztip und des Recherchenetzwerks Correctiv ergeben. Sie fanden heraus: „Hunderte vermeintlich grüne Fonds hielten scheinbar bisher nicht, was sie versprachen“, sagt finanztip-Redakteur Timo Halbe. Die Recherche nahm mehr als 2300 ETFs unter die Lupe, die auf Xetra handelbar sind. „Insgesamt hatten etwa 710 ETFs Nachhaltigkeitsbegriffe im Namen“, sagt Halbe. Bei mindestens 220 ETFs haben die Anbieter in den vergangenen Wochen die Namen angepasst. Auch bei 60 aktiven Fonds fielen Begriffe wie „grün oder „ESG“ aus den Namen. Halbe spricht von einem „großen Beben bei grünen Geldanlagen“. Die BaFin kündigte an, die ESMA-Leitlinien für alle neuen und bestehenden Fonds konsequent anzuwenden.
Ansprüche der Anleger: Für die Anleger führt die Regelung zu mehr Klarheit: „Die Verbraucher können jetzt am Fondsnamen besser sehen, welche Kriterien dahinterstecken“, sagt Halbe. Das ist dringend nötig, denn die Anleger suchen nach Wegen, ihr Geld in soziale und ökologische Anlagen zu stecken. „Es gibt eine große Nachfrage“, bestätigt Klaus Porwoll, Gründer und Inhaber der PecuniArs Gesellschaft für strategische Anlageberatung in Berlin. Die Ansprüche an die Finanzprodukte würden höher. „Geld verdienen ist nicht alles. Es geht den Kunden auch um die Nachfrage und um den Ruf“, berichtet er. Skandale wie der VW-Dieselskandal oder die Skandale in der Modeindustrie belegten, wie sehr es Unternehmen schade, wenn sie ihre Produkte mithilfe von Betrug oder unter menschenverachtenden Bedingungen produzierten.
Um sich abzusichern, dass die gewünschte Geldanlage den eigenen Vorstellungen entspricht, empfehlen die Experten, sich genau zu informieren – zum Beispiel mit Hilfe des Basisinformationsblatts einer Anlage. „Es gibt einen Überblick, wie sich ein Finanzprodukt zusammensetzt“, sagt Halbe. Es enthält eine Produktbeschreibung mit Zielgruppe und Zweckbestimmung der Anlage. „Wenn ein Fonds sich grün nennt, aber in Unternehmen investiert, die stark von fossilen Brennstoffen abhängen oder in Unternehmen der Rüstungsindustrie, könnte dieser Greenwashing betreiben“, sagt Porwoll. Mit Greenwashing ist die Absicht gemeint, dass Produkte umweltfreundlicher oder nachhaltiger aussehen, als sie es tatsächlich sind.
Auf den gängigen Börsenseiten wie finanzen.net, onvista.de oder ariva.de finden sich üblicherweise unter jedem Finanzprodukt viele Daten und Informationen. Halbe empfiehlt darüber hinaus, auf den Seiten der Ausgabeunternehmen wie Amundi, iShares oder XTrackers zu schauen. „Dort gibt es auch Jahresberichte mit mehr Details.“
Wer sich diese Mühe nicht machen wolle, könne bei journalistischen Finanzseiten wie finanztip.de oder test.de von Stiftung Warentest nachschauen. „Sie prüfen regelmäßig Produkte und geben Empfehlungen“, sagt Halbe. Der letzte Bericht von Stiftung Warentest beschreibt zunächst eine Verunsicherung am Markt, aufgrund von möglichem Greenwashing und der Komplexität vieler Produkte. Außerdem befürchteten die Anleger „enttäuschende Renditen“, sagt Autorin Karin Baur.
Den letzten Punkt entkräftet die Untersuchung: „Der nachhaltige Index MSCI World SRI schnitt in den jüngsten fünf Jahren leicht besser ab als der MSCI World“, sagt Baur. SRI steht bei Fonds für Socially Responsible Investment, deutsch: sozial verantwortliches Investieren. In den letzten drei Jahren, oder auch im Vergleich mit dem letzten Jahr, hinkte der MSCI World SRI aber aufgrund der internationalen Konflikte hinterher.
„Nachhaltige Geldanlagen stehen herkömmlichen Anlagen in ihrer wirtschaftlichen Leistung oft in nichts nach“, sagt Porwoll. Studien zeigten, dass sie vergleichbare Renditechancen bieten – teilweise sogar mit geringeren Risiken, etwa im Hinblick auf Reputationsverluste oder Umweltkatastrophen. „Wer in sie investiert, investiert langfristig oft robuster“, sagt Porwoll.
Porwoll gibt zu bedenken: „Nur weil ein Produkt nachhaltig ist, heißt es nicht automatisch, dass es auch sicher oder günstig ist.“ Risiken und Kosten müssten wie bei jeder anderen Geldanlage sorgfältig geprüft werden. Wer sich zu sehr auf nachhaltige Investments konzentriert, riskiert zudem eine sogenannte Klumpenbildung, also dass das Depot eine zu starke Konzentration in einem Bereich enthält. Halbe empfiehlt einen Mittelweg: „Eine breit gestreute Grundlage und dann die am wenigsten nachhaltigen Unternehmen rausstreichen.“ Porwoll schlägt vor: „Erstmal die eigene finanzielle Situation sichern und dann mit den erzielten Renditen Gutes tun.“
Autorin: Mechthild Hennecke
Dieser Artikel wurde am 29.06.2025 auf berliner-zeitung.de veröffentlicht.